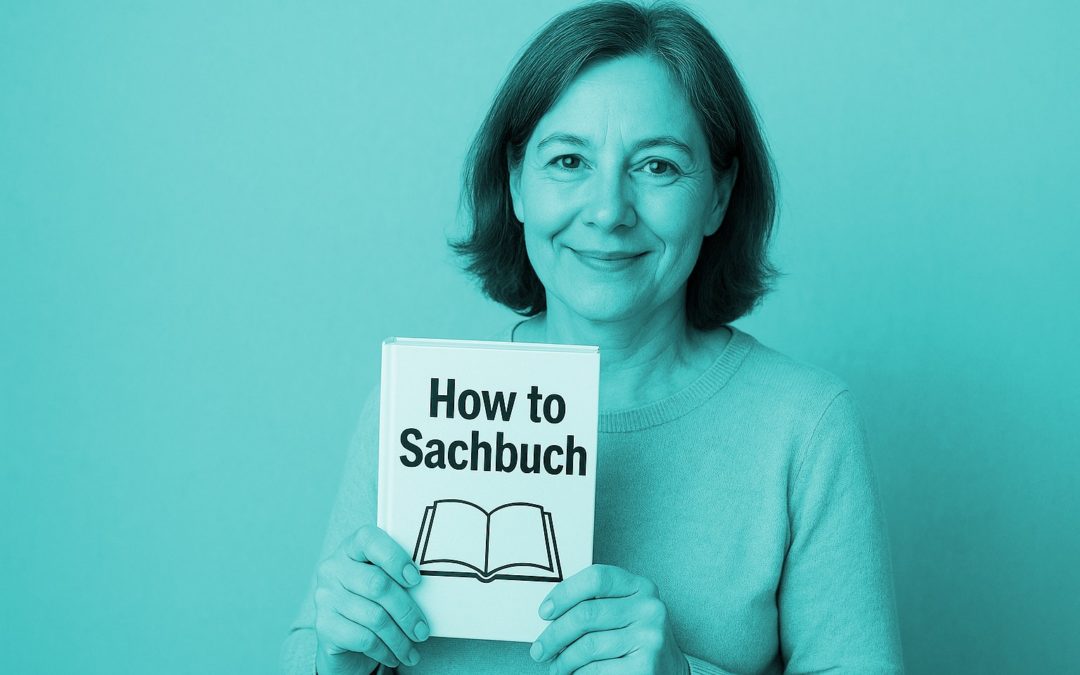Gleich vorweg: Es gibt keine allumfassende Anleitung, wie du es schaffst, ein gutes Sachbuch zu schreiben. Aber natürlich haben viele Autor:innen und andere Expert:innen Ideen und Tipps dazu, und ich natürlich auch. Wenn ich dich in diesem Blogbeitrag zu etwas ermutigen kann, dann sollte es auf jeden Fall das sein: Mach dir klar, welches ganz konkrete Thema du behandeln willst, warum es wichtig ist und wie du die zentrale Frage deines Buches beantworten kannst. Und zwar bevor du den ersten Satz in die Tastatur klopfst. Soll heißen: Du brauchst ein Konzept und eine Struktur. Die machen deine Buchreise nicht nur leichter, sondern auch sinnvoller. Egal, ob mit oder ohne Ghostwriter.
Warum willst du ein Sachbuch schreiben oder schreiben lassen?
Wenn du bei der Frage nach dem Wie gelandet bist, dann hast du schon entschieden, dass du ein Sachbuch brauchst / schreiben möchtest. Sehr gut. Jetzt stellt sich die Frage: Warum? In meinen Erstgesprächen zum Ghostwriting und auch, wenn ich mit jemandem an seinem / ihrem Konzept arbeite, will ich genau das von meinem Gegenüber wissen: Was ist deine Motivation für das Buchprojekt? Die Antwort auf diese Frage ist wichtig, denn sie hat Auswirkungen auf das ganze Buch und den Weg dorthin.
Um es gleich klar zu sagen: Sollte deine Motivation rein finanzieller Natur sein, denk noch mal drüber nach! Mit den Tantiemen allein wirst du höchstwahrscheinlich nicht reich. Indirekt kann dir ein gutes Buch allerdings durchaus helfen, dein Business anzukurbeln und deine Glaubwürdigkeit sowie deine Expertise – also dein Image – zu unterstreichen. Wichtig sind aber auch die nicht finanziellen Motive z. B. wenn du als Ärztin deine Patient:innen unterstützen oder als Steuerberater deine Klient:innen darüber aufklären möchtest, was sie als Neugründer:innen steuerlich erwartet.
Warum gute Sachbücher gebraucht werden
Holen wir das Thema einmal auf eine allgemeinere Ebene. Warum sollten wir in der heutigen Zeit, in der man mit KI in Windeseile fast jede Frage beantworten kann, überhaupt noch ein Sachbuch lesen wollen?
Dafür gibt es eine Menge nachvollziehbare Gründe, zum Beispiel die:
- Ein Sachbuch geht weit mehr in die Tiefe und liefert fundierteres Wissen, als es die KI es kann.
- Die Leser:innen bekommen ein Gefühl für die Autorin oder den Autor und können sich ein Bild machen, mit welchem Menschen sie es zu tun haben.
- Bei guten Sachbüchern erhält man ein Gefühl für das Thema, weil man sich aufgrund des Storytellings und der Beispiele wirklich etwas vorstellen kann.
- Ein Buch ist etwas Handfestes. Es ist möglich, darin herumzustreichen, Dinge zu markieren und Eselsohren reinzumachen (absichtlich oder nicht). Damit merkt man sich das Geschriebene wesentlich leichter, als die Inhalte ausschließlich digital zu konsumieren.
- Ein Buch, eine Quelle: Lässt man sich Inhalte von der KI zusammenstellen, dann hat sie die Inhalte in allerlei Websites, Blogs oder Videos gesucht und dann zusammengewürfelt. Selbst wenn man immer auf den zugehörigen Link klickt, wird das Ganze irgendwann unübersichtlich. Ganz abgesehen davon, dass viele Ergebnisse schlicht und ergreifend falsch sind. Bei einem Buch gibt es dieses Problem nicht. Und die Quellen finden sich ganz oft übersichtlich in einem eigenen Verzeichnis.
Bevor du zu schreiben beginnst
Wie gehst du es nun an? Bitte nicht, indem du wild drauflos zu schreiben beginnst und das noch großteils mithilfe der KI. Das sind nämlich die Texte, die derzeit gehäuft auf meinem Schreibtisch landen, weil die Autorin oder der Autor irgendwann selbst gemerkt hat, dass da was ganz und gar nicht passt. Mach es besser!
Überlege dir vorher: Was soll bleiben, wenn die Leser:innen die letzte Zeile gelesen haben?
Was haben sie gelernt? Welches Wissen können sie jetzt nutzen, das sie vorher nicht hatten? Welchen Vorteil haben sie jetzt im Vergleich zu jenen, die das Buch nicht gelesen haben?
Wenn du das weißt, dann weißt du auch, worauf du im ganzen Prozess hinarbeiten musst. Oder eben ich als dein Ghostwriter, wenn wir vorher gemeinsam erarbeitet haben, was der Benefit deines Buchs sein soll.
Von der Idee zum Konzept
Unabhängig davon, ob du in einem Verlag veröffentlichen möchtest oder dein Buch selbst herausgeben möchtest:Du brauchst ein Konzept.
Die Zielgruppenanalyse
Dazu gehört einmal eine gründliche Zielgruppenanalyse. Nicht nur nach demografischen Merkmalen, sondern auch nach der Situation, in der sich die Leser:innen gerade befinden.
Sind es z. B. Frauen 50+, die mitten im Beruf stehen und merken, dass ihnen die Wechselsymptome ordentlich zu schaffen machen, während sie sich mehr denn je im Job behaupten müssen, um ihre hart erkämpfte Leitungsfunktion nicht zu verlieren?
Oder sind es Gründer:innen, die sich in ihrem Metier wunderbar auskennen, eine erste Förderung für ihr Start-up erhalten haben, gerade die neuen Büroräumlichkeiten bezogen haben, aber keine Ahnung haben, wie sie die Sache mit den Steuern angehen sollen?
Die Konkurrenzanalyse
Außerdem ist es hilfreich zu wissen, welche Bücher es zu deinem Thema es schon auf dem Markt gibt. Was kannst du, was bringst du ein, das darin noch nicht steht? Überleg dir: Was gefällt dir an diesen Büchern und was nicht? Was ist dein Stil? Nicht nur, was den Text betrifft, sondern auch Aufbau und Layout.
Der Pitch
Wenn du das alles weißt, kannst du (gerne auch gemeinsam mit mir) eine Art Pitch ausarbeiten.
In deinem Pitch sollten vorkommen: Deine Zielgruppe, das Ziel des Buches für die Leser:innen und der Weg, wie du sie zum Ziel führst.
Z. B. „Mit meinem Buch zum Thema Protein als wichtig(st)er Baustein gesunder Ernährung erkläre ich berufstätigen Müttern mit kleinen Kindern und wenig Freizeit, wie sie in weniger als 15 Minuten pro Tag eine ausreichende Menge Eiweiß in ihre Mahlzeiten integrieren können, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Um das zu erreichen, gebe ich detaillierte Informationen über die einzelnen Proteinquellen und wie man sie nützt. Außerdem runde ich das Ganze mit 20 einfachen Rezepten für gesunde und schmackhafte Mahlzeiten ab.“
Die Struktur
Jetzt weißt du schon ziemlich viel. Was du noch brauchst, ist ein Weg durch dein Buch. Auch Struktur genannt.
Denk daran: Wenn die Struktur nicht nachvollziehbar ist, verlierst du deine Leser:innen recht schnell.
Natürlich gibt es viele Methoden, wie du an eine Struktur kommst.
Ich empfehle dir eine Mischung aus Bottom-up und Top-down, die ich dir anhand der folgenden Beispiele erkläre. Dafür kannst du z. B. eine Mindmap verwenden.
- Schreib die großen Themenblöcke, die für dich sinnvoll sind, einfach mal auf. Das kann ruhig ungeordnet sein. Z. B. Was sind Proteine überhaupt? Warum brauchen wir Proteine? Wie viele Proteine müssen wir essen? In welchen Lebensmitteln sind Proteine enthalten? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
- Zusätzlich notierst du dir einzelne Aspekte, die dir wichtig sind. Auf Post-its, anderen Zetteln oder in einer App. Wie du willst, Hauptsache du sammelst sie. Darauf könnte stehen: Was ist der Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen? Woher weiß ich, wie viele Proteine in einem Nahrungsmittel sind? Brauchen Männer mehr Eiweiß als Frauen? Kann man Proteine auch überdosieren? Klar, worauf ich hinauswill, oder?
- Wenn dir nichts mehr einfällt, dann ordnest du die einzelnen Punkte den großen Themenblöcken zu. Und wenn etwas nirgendwo dazu passt und trotzdem wichtig ist, dann ergänzt du eine Kapitelüberschrift.
Voilà, und schon hast du ein erstes Inhaltsverzeichnis! Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und wird sich im Laufe des Schreibprozesses noch ändern.
Jetzt darfst du anfangen, dein gutes Sachbuch zu schreiben!
Natürlich kann ich dir jetzt keine Anleitung dafür geben, wie du deine Kapitel bzw. deine Inhalte perfekt formulierst. Dazu gehören viel Erfahrung, Ausbildung, jede Menge Feedback und noch eine Menge mehr.
Aber ein paar Tipps habe ich:
- Sei du selbst! Auch wenn du in anderen Büchern oder Texten einen Stil gefunden hast, der dir zusagt: Es ist nicht deiner. Denk immer daran, wie du etwas in einem Gespräch sagen würdest und schreib auch so!
- Denk an deine Zielgruppe! Hat sie das nötige Hintergrundwissen, um zu verstehen, was du gerade geschrieben hast, musst du noch mehr erklären oder ist es gar umgekehrt?
- Fakten sind wichtig, Geschichten sind es auch! Bring Beispiele aus deinem (beruflichen) Alltag, berichte über eigene Erfahrungen. Kurz: Mach den Inhalt anschaulich und zwar so, dass sich die Leser:innen praktisch etwas vorstellen können.
- Verzichte auf Textwüsten! Überschriften, Absätze und andere Stilelemente wie ein Fazit oder eine Kapitelvorschau lockern auf.
- Informiere dich über die gängigen Schreibregeln! Dazu gehören eine abwechslungsreiche und aktive Sprache, möglichst wenige Substantivierungen und Füllwörter, das Einbauen der Sinne u. v. m.
- Komm zum Punkt! Eier nicht herum, sondern sag, was Sache ist. Am Anfang des Kapitels, des Absatzes, ja, sogar des Satzes!
- Verzichte auf Quellenangaben mitten im Text! Du kannst natürlich Hinweise geben (Müller und Kollegen haben schon 1987 in einer Studie herausgefunden, dass …), aber stelle die echten Quellen lieber ans Ende. Sonst wird die Sache unlesbar.
Lass die Leser:innen von einem Kapitel ins andere rutschen
Schon mal von der Slippery Slide gehört? Dieses Prinzip aus dem Copywriting besagt, dass deine Leser:innen von einem Satz zum nächsten, von Absatz zu Absatz und von Kapitel zu Kapitel „rutschen“ sollen. Und zwar deshalb, weil sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht.
Ein paar Beispiele:
- Du beginnst ein Kapitel nicht mit „Kapitel 3: Die Bedeutung des Vitamin-D-Stoffwechsels“, sondern mit: „Was passiert, wenn du vier Wochen lang kein Sonnenlicht bekommst?“
- Du erklärst nicht nur einen Begriff, sondern erzählst, wie er im echten Leben wirkt. Statt: „Neuroplastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern“ schreibe lieber: „Wenn du eine neue Sprache lernst oder ein Instrument spielst, formt dein Gehirn buchstäblich neue Verbindungen – das ist Neuroplastizität.“
- Du beendest ein Kapitel nicht mit einem Fazit, sondern mit einem Cliffhanger: „Doch was viele Ärzt:innen dabei übersehen, ist eine Kleinigkeit mit großer Wirkung …“
So entsteht Lesefluss und das selbst bei komplexen Themen.
Außerdem gehören ganz banale Dinge dazu, wie:
- Struktur
- Abstände
- Überschriften
- Aufzählungen etc.
Denn am Ende will niemand ein Sachbuch lesen, das sich anfühlt wie ein steiler Aufstieg, sondern eher wie eine Rutsche, die man gleich noch mal runterrutschen will.
Nach dem Schreiben ist vor der Überarbeitung
Glaubt man Stephen King, dann sollten zwischen Erstfassung und Überarbeitung mindestens sechs Wochen liegen. In seinem Buch „Das Leben und das Schreiben“ geht es allerdings um Belletristik. Vom Prinzip her hat er allerdings recht.
Ein ordentlicher Abstand verändert die Perspektive und du schaffst es leichter, Unnötiges wegzulassen, Übergänge flüssiger zu gestalten und den roten Faden klarer zu machen.
Lust auf ein eigenes Buch bekommen?
Du siehst, es sind also ganz viele Dinge zu beachten, wenn du ein gutes Sachbuch schreiben willst. Das Coole ist: Mit jedem Buch, das du schreibst, wirst du besser und es fällt dir leichter, deine Ideen in Worte zu kleiden und in die Tastatur zu klopfen.
Wenn du Hilfe brauchst, ist das auch keine Schande, sondern ein Zeichen für die richtige Selbsteinschätzung. Gib mir ein Zeichen, wir finden sicher einen Weg, wie ich dich unterstützen kann!
Mehr Tipps und Infos erhältst du in meinem jede zweite Woche erscheinenden Newsletter. Und wie du mit mir arbeiten kannst, erfährst du in einem Gespräch in einem kostenfreien Erstgespräch mit mir! Ich freue mich auf dich!